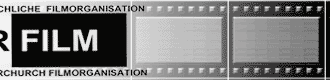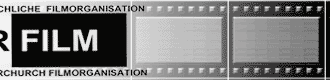Europäischer John Templeton-Filmpreis 2003
Predigt zur Preisverleihung Filmkritik
Der Templeton European Film Award wird einmal im Jahr seit 1997 im Auftrag der renommierten Templeton Foundation mit Sitz in den USA durch die Internationale kirchliche Filmorganisation INTERFILM und die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), Genf, an einen europäischen Film vergeben. Der Film, der von einer dreiköpfigen ökumenischen Jury nominiert wird, wird aus den Preisträgern kirchlicher Jurys (entweder einer Ökumenischen Jury oder einer Interfilm-Jury) und den „Filmen des Monats“ der Jury der Evangelischen Filmarbeit in Deutschland oder des Evangelischen und Katholischen Filmbeauftragten der Schweiz ausgewählt. Der Preis ist (seit 2005) mit 10.000 € dotiert und mit einer Urkunde verbunden.

Europäischer Templeton-Filmpreis des Jahres 2003
Der 7. Europäische John Templeton Filmpreis wird verliehen an den Film
Die Rückkehr (Vosvraschtschenie)
von Andrej Svjagincev, Russland
Dieses kraftvolle und vielschichtige Filmdebut, das psychologische, politische und archetypische Interpretationen ermöglicht, erzählt die Geschichte eines Vaters, der nach zwölfjähriger Abwesenheit zu seinen beiden halbwüchsigen Söhnen zurückkehrt. Sie identifizieren ihn nur anhand einer alten Fotografie, die sie in einer illustrierten Bibel aufbewahren - und die sich auf einer Seite öffnet, die das Opfer Isaaks durch Abraham zeigt.
Der Anspruch auf Durchsetzung des väterlichen Willens erzeugt bei den beiden Kindern gegensätzliche Reaktionen und verändert das Familienleben. Der als "Eindringling" wahrgenommene Vater glaubt zu wissen, wie sie sich verhalten sollten: als ordentliche und gehorsame Söhne. Als sie zu dritt zu einer Fahrt in die Wildnis aufbrechen, spitzt sich der Beziehungskonflikt exemplarisch zu. Das unausweichliche tragische Ende spielt sich in einer eindrucksvollen nordrussischen Seenlandschaft ab.
Die ökumenische Jury würdigt mit ihrer Auszeichnung die Komplexität und ästhetische Qualität des Films. Der Regisseur, Andrej Svjagincev, sagt selbst, dass er "keine alltägliche oder soziale Geschichte" erzählen wollte. Er sieht darin vielmehr "einen mythologischen Blick auf das menschliche Leben."
Der Film gewann in Venedig den "Goldenen Löwen" und den SIGNIS-Filmpreis sowie den Preis der Ökumenischen Jury beim Festival des Osteuropäischen Films in Cottbus 2003.
Der Templeton European Film Award wird im Auftrag der renommierten Templeton Foundation mit Sitz in den USA durch die Internationale kirchliche Filmorganisation INTERFILM und die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) vergeben. Der Preis ist mit 10.000 CHFr dotiert und mit einer Urkunde verbunden. Er wird Filmen verliehen, die
- sich durch besondere künstlerische Qualität auszeichnen
- einer menschlichen Haltung Ausdruck geben, die mit der biblischen Botschaft übereinstimmt oder sie zur Debatte stellt
- die das Publikum zur Auseinandersetzung mit spirituellen oder sozialen Werten und Fragen anregt
Die aus drei INTERFILM-Mitgliedern bestehende internationale Jury bezog fünf Filme in die Endauswahl ein und entschied zuletzt zwischen dem endgültigen Preisträger und einem zweiten russischen Film, "Babusja" (Großmutter) von Lidija Bobrova.
Filmkritik
Preisverleihung
Die Verleihung des John Templeton European Film of the Year Awards fand wie in den vorangegangenen Jahren im Rahmen eines Gottesdienstes in der St. Matthäuskirche in Berlin am 8. Februar 2004 statt. Der Preisträger, Andrej Zvjagincev, nahm Urkunde und Preisgeld aus den Händen von Pamela Thomson, Repräsentantin der Templeton Foundation, persönlich und sichtlich bewegt entgegen. Die Predigt zur Preisverleihung hielt INTERFILM-Präsident Hans Werner Dannowski. Wir dokumentieren im folgenden seinen Predigttext.
P r e d i g t
im Gottesdienst zur Verleihung des Templeton-Filmpreises 2003
an den Film WOSWRASCHTSCHENIJE/THE RETURN/DIE RÜCKKEHR
von Andrey Zvyagnitsev am 8. Februar 2004 um 18.00 Uhr
in der Matthäuskirche Berlin
von Hans Werner Dannowski
„Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia,
ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt
Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen
und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf dass
ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann
schlage“.
Maleachi 3, 23 + 24
Liebe Gemeinde! Ein Vater kehrt zurück. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel. Zehn Jahre ist er fort gewesen, man weiß nicht, wo. Vielleicht war er im Gefängnis, einige dubiose Tauschgeschäfte und geheime Telefonate deuten darauf hin. Vielleicht war er auch im Krieg, in Tschetschenien oder wer weiß, wo. Für die beiden Söhne ist er ein fremder Mann. Auf alten Fotos stellen sie die Ähnlichkeit mühsam fest. Da wird der Kleine von dem Vater hochgehoben, der Große sitzt daneben, die Mutter lacht. Eine glückliche Zeit war das damals offenbar. Aber jetzt ist alles anders.
Ja, die Väter und die Söhne. Mit großer Eindringlichkeit weist der Film DIE RÜCKKEHR auf ein Thema, das man so schnell als nebensächlich beiseitestellt. Die Bedeutung, die die Mütter für das Leben und Glück oder Unglück der Kinder haben, liegt auf der Hand. Sie haben die Kinder neun Monate in ihrem Leib getragen, haben sie unter Schmerzen zur Welt gebracht, haben sie genährt, umsorgt, gehütet. Von der Liebe der Mutter und der Großmutter, der Babuschka, haben Andrej und vor allem Ivan bisher gelebt. Aber die Väter....? Dabei haben wir doch alle einen Vater gehabt, in welchem Verhältnis wir auch zu ihm standen und er zu uns. Man könnte einen Augenblick lang an seinen eigenen Vater denken....
Vielleicht hängt die Vernachlässigung dieses Themas, sage ich mir, damit zusammen, dass die Männer als Väter oft sehr in den Hintergrund getreten sind. Erst in den letzten Jahren scheint sich da etwas zu verändern. Ich habe mir sofort, nachdem ich den Film gesehen hatte, das 50 Jahre alte Buch eines meiner theologischen Lehrer in Hamburg aus dem Regal geholt. „Die Welt ohne Väter“ ist sein Titel. Die Krise der väterlichen Autorität in allen Lebensbereichen, von der Familie über Schule und Staat bis zur Kirche wird da herausgestellt. Das „Zeitalter des Sohnes“, in dem wir heute leben, wird konstatiert. Als hätte Hans-Rudolf Müller-Schwefe den Film DIE RÜCKKEHR gerade eben auch gesehen.
Es mag auch sein, liebe Gemeinde, dass mit dem Vater, der mit rigorosen Methoden einen Platz im Leben seiner Söhne zu finden sucht, insgeheim „Väterchen Rußland“ gemeint ist. Die Rolle, die Rußland im Verhältnis zu seinen Bürgern und Volksgruppen spielt, die in eine größere Freiheit entlassen sind, ist ja nicht leicht zu definieren und zu finden. Geradezu mythische Räume und Weiten sind das, in die uns die ruhigen Bilder des Films suggestiv hineinziehen.

Der Ladogasee mit seinen plötzlichen Stürmen, der Regen kommt wie eine Sintflut, die dunklen Wolken und die endlosen Wälder. All die großen geheinmisvollen Vater-Sohn-Geschichten der Menschheit sind mir beim Anschauen der RÜCKKEHR eingefallen, von Ödipus und seinem Vater, den er unerkannt erschlägt, bis zu dem heimkehrenden Odysseus und seinem Telemach. Ja, vielleicht ist sogar die allerumfassendste Vater-Kind-Beziehung angedeutet, die wir im Gebet des „Vater unser“ in Worte zu fassen suchen. Der Vater, der im Himmel ist. Der auch so oft und so lange abwesend ist, dass man ihn manchmal nicht einmal mehr vermisst. Es wird kein Zufall sein, dass der Film sich in die sieben Schöpfungstage gliedert, freilich in der christlichen Deutung, die mit dem Sonntag, dem Auferstehungstag, beginnt und mit Samstag, dem Tag der Grablegung Christi, endet. Und dass die ikonographische Gestaltung des schlafenden und des toten Vaters den Renaissancebildern vom toten Christus, etwa von Andrea Mantegna, nachgebildet ist.
Es ist die Weisheit und die künstlerische Kraft von Andrey Zvjagincev, dass er all diese möglichen Bezüge nur andeutet, sie der Aufmerksamkeit und dem Deutungsvermögen seiner Zuschauer überlässt. Einfach eine Geschichte erzählt er von der Rückkehr eines Vaters zu seinen zwei Söhnen, die an die existentiellen Grunderfahrungen des Menschseins überhaupt in dieser unserer Welt rührt. Eine Lebenserfahrung ist es, die so elementar ist, dass Gott - so sagt es der Bibeltext aus dem Propheten Maleachi, den ich zu dem Film hinzugenommen habe - vor dem Kommen des Messias noch einen Boten schicken wird, der die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern kehrt. Erst wenn sich die Väter und die Söhne ganz zueinander hin öffnen, ist das Reich Gottes da.

Aber nun muss ich vor allem denen, die den Film DIE RÜCKKEHR noch nicht gesehen haben, die Geschichte ein wenig weitererzählen. Da taucht der so lange abwesende Vater auf, nimmt die beiden Söhne in seinem Auto auf eine Fahrt mit, die kurz sein soll und immer länger dauert und zu einem Überlebenstraining ihrer wechselseitigen Beziehung wird. Der Rückkehrer versucht, die Rolle des Vaters im Leben seiner Söhne wieder zu gewinnen. Zu essen gibt es, wenn er es will. Auf eine Insel fährt man, wo er etwas vergraben hat. Die Söhne haben zu der Zeit vom Fischen wieder da zu sein, die er bestimmt. Die Jungen setzen gegen die väterlichen Anordnungen ihre eigene Struktur; als die Kollision da ist, sind auch die Strafen da. Das Aussetzen von Ivan bei strömendem Regen auf der Straße, die Ohrfeigen, die Andrej erhält. Schnell ist die Klimax des Films dann erreicht. Der plötzliche Ausbruch des Hasses ist wie ein Sturm. Zuerst bei Ivan, der dem Vater von vornherein reserviert gegenübergestanden hat. Dann bei Andrej, fast zugleich auch beim Vater. Und ich sehe die Szene noch immer vor mir, in der Ivan mit dem Messer auf den Vater losgeht, als dieser - wie einst Abraham und Isaak - mit dem Beil in der Hand über Andrej steht. Vielleicht doch auch mit dem Wunsch, dass noch ein Engel dazwischentritt. „Ich könnte dich lieben, wenn du anders wärst“, schreit Ivan dem Vater entgegen. „Aber ich hasse dich“.
Ja, dieser plötzliche Ausbruch von Hass und Wut und Vernichtungsdrang. Wie Schuppen ist es mir bei der RÜCKKEHR von den Augen gefallen: Der Hass hat auch seine konstruktive Seite. Hass will die seelische Voraussetzung für die Liebe schaffen, und manchmal gelingt dies auch. Da haben wir, gerade in den christlichen Kirchen, den Hass unter ein absolutes Verbotsurteil gestellt und damit doch nur erreicht, dass er untergründig die Beziehungen vergiftet. Liebe und Destruktivität bleiben aufeinander bezogen, und der Hass setzt oft genug die seelischen Energien frei, die die Liebe braucht, um wirklich ganz bei sich selbst und ganz beim Anderen zu sein. Hass entdeckt die plötzliche Fremdheit des Anderen, die mich bedroht. Erst sieht man rot, könnte besinnungslos alles zerschlagen. Und auf einmal, manchmal freilich nur, weiß man, dass das Fremde zu mir gehört. Dass ich es lieben kann. So wie der Vater und die Söhne, mit gezücktem Messer und erhobenem Beil, auf einmal wissen, dass sie zueinander gehören. Dass sie sich im Grunde - lieben. Der Kleine jagt davon, will sich vom Leuchtturm stürzen. Der Vater hinterher, Sohn, ruft er, Sohn, tus nicht. Wer in den Tod stürzt, ist nicht der Junge. Es ist der Vater.
Das Ziel, der innere Sinn des Hasses ist - die Liebe. Vielleicht ist unsere Liebe so schwach, geht mir durch den Kopf, weil unser Hass so gebrochen ist. Wenn wir, nach dem Wort Jesu, in seiner Nachfolge den Bruder auch hassen könnten - den Bruder, so verstehe ich das, der Andere mit seinem Egoismus und seinen Allmachtsphantasien wissentlich oder unwillentlich versklavt und niedermacht. Wenn wir ihm oder ihr ins Gesicht schreien würden: „Ich könnte dich lieben, wenn du anders wärst“ - dann würden wir wahrscheinlich mehr an Schönheit und Güte aus uns und aus Anderen herauslieben können, als wir ahnen. Wenn es stimmt, dass die Liebe stark ist wie der Tod, dann braucht das eine Energie, die auch manchmal rot sieht, ehe sie den Anderen umarmt.
Dann fahren die beiden Söhne mit dem toten Vater im Boot zurück von der Insel. Ehe der Motor anspringt, gleitet das Boot eine Weile lautlos in einem Silberstreifen, als führe es direkt in ein wunderbares Land. Die beiden Jungen sitzen schweigend im Boot, halten später, am Ufer, die Totenwache. Viel ist da nicht zu sagen. Die Verwandlung von Gleichgültigkeit über den Hass in die Liebe ist nicht immer einfach so zu haben. Dass Versöhnung Opfer fordert, wissen wir aus unserem christlichen Glauben heraus genau. Manchmal weiß man erst hinterher, dass der, der daran gestorben ist, der bergende Schutz war, den wir im Leben hatten. Aber immerhin: Dieses Wissen bricht sich bei den beiden Söhnen genau so eruptiv Bahn wie vorher der Hass. Als sich das Boot mit dem toten Vater vom Ufer losreißt und langsam sinkt, laufen Andrej und Ivan bis ins tiefe Wasser hinterher. Gerade Ivan kann nicht aufhören, das Wort zu rufen, das ihm vorher nicht über die Lippen wollte. Papa, ruft er ihm hinterher, Papa.
Mit dem abwesenden Vater leben: Das wird künftig der Weg von Andrej und Ivan sein. Wir bleiben alle nicht Kinder. Wir werden erwachsen, müssen ohne Väter und Mütter leben. Bilder bleiben und Erinnerungen, das ist viel. Aber Geborgenheit, Gewissheit eines guten Weges und Lebenszuversicht wird es nur geben, wenn sich die Wunde des ungeliebten Kindes geschlossen hat. Das gilt für das Verhältnis der Söhne und Töchter zu ihren irdischen Vätern und Müttern, die eines Tages nicht mehr da sind. Die wir aber mit dem, was sie uns und wir ihnen gegeben haben, bis an unser Lebensende mit uns tragen. Das gilt in gleicher Weise für unsere Beziehung zu dem Grund allen Seins, den wir uns als ein personales Gegenüber denken und „unseren Vater im Himmel“ nennen. Die Wunde des ungewollten und ungeliebten und sinnlosen Lebens macht jedes Leben rundherum kaputt. An, wie Dorothee Sölle das einmal gesagt hat: An den „ontologischen Vorrang des Seins vor dem Nichts“ glauben. Gott seine gute Schöpfung, seine Liebe und seine Gerechtigkeit glauben und daraufhin leben, darum wird es gehen. Die Gewissheit weitertragen, dass dieser Vater, dessen Abwesenheit wir lange Zeit oft nicht bemerken, um dessen Anwesenheit wir dann wieder leidenschaftlich bitten: Dass dieser Vater wie eine gute Mutter ist.
Eine wunderbare Parabel für zutiefst krisenhaftes, aber zuletzt doch gelingendes Leben hat Andrej Zvjagincev mit seinem Film DIE RÜCKKEHR uns gegeben. So erhält dieser Film, in seiner Einheit von künstlerischer Gestaltung und inhaltlicher Durchdringung, nach meinem Urteil mit hoher Berechtigung den Templeton-Filmpreis 2003. In einem wissenden Spiel des Lebens wird das vorweggenommen und eingeübt, was der Prophet vom Jüngsten Tag, von der Erfüllung des Lebens und aller Zeiten sagt. Dass da einer kommen wird, um das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern zu kehren. Wenn das eintritt, in großem Umfang eintritt, dann ist wohl das Reich Gottes da.
The Return – Die Rückkehr
Ein Filmdebüt vom Format eines Kinoklassikers
Von Karsten Visarius
Der russische Regisseur Andrej Swjaginzew erzählt in denkbar knappster und konzentriertester Form vom Kampf zwischen Autorität und Auflehnung, vom Konflikt zwischen einem Vater und seinen beiden Söhnen. "The Return – Die Rückkehr" ist auch Film des Monats (April 2004) der Evangelischen Filmjury.
Mit der Axt steht der Vater über seinem in den Sand gestürzten älteren Sohn, wütend und außer sich, mit gezücktem Messer droht der jüngere, ihn umzubringen. Ein Kreis, ein unheilvoller Zirkel scheint sich zu schließen, an dessen Anfang das Bild von dem zur Opferung Isaaks bereiten Abraham in einer illustrierten Bibel steht. Zwischen den Seiten des auf dem Dachboden verstaubenden Bandes haben der vielleicht zwölfjährige Iwan und der schon von Pubertätsmalen gezeichnete Andrej ein Kindheitsfoto gesucht, den Beweis, dass der schlafende Fremde im Haus der zurückgekehrte Vater ist. Eine weiße Feder hat sich schwankend auf dem Kopfkissen des Schläfers niedergelassen. Sie ist direkt aus Andrej Tarkowskijs "Nostalghia", in dem ein abwesender Vater durch seine Gedichte vertreten wird, in Swjaginzews Film hinüber geschwebt. Schon diese wenigen Motive verraten etwas von der Dichte einer Erzählung, die sich klar und ohne Schnörkel vor unseren Augen entwickelt, von einem Sonntag bis zum Sonnabend, ganze kurze sieben Tage einer Woche.
Klarheit und Geheimnis sind für die Kunst dieses Films keine Gegensätze. Er beginnt mit einer Mutprobe unter Heranwachsenden, die Iwan, der Jüngste, nicht besteht. Alle springen sie vom Turmgerüst eines Küstendammes ins Wasser, alle bis auf ihn, der von Angst und Spott gelähmt, bebend vor Kälte und Scham hoch oben zurückbleibt. Die Mutter holt ihn zurück, tröstend, mit beruhigenden Worten hüllt ihre Umarmung ihn ein. Schon diese Szene des Prologs genügt, um auch sie unvergesslich zu machen. Die Kränkung bleibt. Sie nährt einen rebellischen Trotz, der sich bis zu Mord- und Todesbereitschaft steigert. Sie muss in Gesten der Selbstgewissheit und Selbstbehauptung immer wieder zum Vergessen gebracht werden.
Der Trotz stößt auf einen Mann, der für vaterlos aufgewachsene Söhne plötzlich Vater sein will. Seine Abwesenheit bleibt ein ungeklärtes Rätsel. Ob er Soldat in irgendeinem Krieg, ob er Strafgefangener war, ob er der Familie entfloh und die Freiheit eines anderen Lebens suchte, bleibt unseren Vermutungen überlassen. Der Film streut vieldeutige Hinweise aus. Er sei Pilot, hat die Mutter den Kindern erzählt und ihre Fantasien entzündet. Der abwesende, fremde und dann doch wieder gegenwärtige Vater ist ein blinder Fleck, für den auch wir eine Bestimmung suchen. Bilder müssen ihn füllen wie das Abendmahl, zu dem er die Familie versammelt und Wein und Fleisch verteilt. Bilder und ein traditionsverhaftetes, autoritäres Verhaltensrepertoire, das die Unbestimmtheit überspielt. Papa sollen die Söhne ihn nennen, lautet eine seiner Regeln, der Andrej williger als Iwan gehorcht. Sie ist ebenso selbstverständlich wie willkürlich, nicht anders als andere Regeln, die wir mal befolgen, mal bezweifeln.
Weil wir den Vater meist mit den Augen Iwans und Andrejs sehen, fallen uns vor allem sein barscher Ton, seine strengen Anweisungen und Bestrafungen auf. Ein Versprechen, ein Abenteuer, die gemeinsame Autofahrt zum Fischen an einem See bietet reichlich Gelegenheit, Rituale des Gehorsams und des Widerstands aufeinander prallen zu lassen, und sei es nur im Konflikt um die Banalität, eine Suppe auszulöffeln.  Der Anlass steht in schärfstem Kontrast zur Dramatik der Szene. Der hungrige Iwan weigert sich, das bestellte Gericht anzurühren. Der Vater setzt ihm eine Frist. Die Kraftprobe bleibt in der Schwebe, ein reines Gleichnis. Immerhin lernt das Kind, wie man die Kellnerin höflich herbeiruft, so schäbig und zufällig das Lokal in der russischen Provinz auch sei. Und, mit dem zweiten Blick, erkennen wir, wie der dem Der Anlass steht in schärfstem Kontrast zur Dramatik der Szene. Der hungrige Iwan weigert sich, das bestellte Gericht anzurühren. Der Vater setzt ihm eine Frist. Die Kraftprobe bleibt in der Schwebe, ein reines Gleichnis. Immerhin lernt das Kind, wie man die Kellnerin höflich herbeiruft, so schäbig und zufällig das Lokal in der russischen Provinz auch sei. Und, mit dem zweiten Blick, erkennen wir, wie der dem  Vater Trotz bietende Sohn eine Gabe der Natur missachtet. Vorschnelle Sympathien, die auf unserem Einverständnis mit dem Aufstand der Söhne beruhen, halten der Erzählung Swjaginzews nicht stand. Trotzdem folgen wir noch immer der Spur, die Iwan Turgenjews politisch-psychologischer Roman "Väter und Söhne" im 19. Jahrhundert vorgezeichnet hat, der Attraktion eines Bewusstseins, das die Vater Trotz bietende Sohn eine Gabe der Natur missachtet. Vorschnelle Sympathien, die auf unserem Einverständnis mit dem Aufstand der Söhne beruhen, halten der Erzählung Swjaginzews nicht stand. Trotzdem folgen wir noch immer der Spur, die Iwan Turgenjews politisch-psychologischer Roman "Väter und Söhne" im 19. Jahrhundert vorgezeichnet hat, der Attraktion eines Bewusstseins, das die  Überlieferung abgeschüttelt hat. Überlieferung abgeschüttelt hat.
Auf einer Insel im Nirgendwo entlädt sich die aufgestaute Spannung. Ein archaischer Mythos, den Freuds Psychoanalyse aktualisiert hat, kehrt zurück – auch wenn es wie in den Filmen Hitchcocks nur wie ein Zufall aussieht. Wir haben uns, sagt Freud, diesen Zufall gewünscht. Und erkennen erst im Nachhinein den Verlust, den wir dabei erlitten haben. Der Regisseur selbst hat von einem "mythologischen Blick auf das menschliche Leben" gesprochen, der seinem Film zugrunde liege. In einer Montage schwarzweißer Fotografien, einem Epilog, der dem Ende folgt, deutet Andrej Swjaginzew eine glücklichere Variante seiner Erzählung an, einen Film ohne Fragen. Ganz diskret haben Abrahamsopfer, Abendmahl, der Anklang an ein von Andrea Mantegna gemaltes, schon in Pasolinis "Accatone" zitiertes Bild von Christus im Todesschlaf Motive der christlich-jüdischen Tradition und das Thema eines geschichtlich verstummten, abwesenden Vater-Gottes ins Gedächtnis gerufen. Fangen wir an, uns Fragen zu stellen. Im Geist dieses Anfangs hat eine Crew enthusiastischer Debutanten, vom Regisseur über Komponist, Schauspieler, Kameramann bis zum Produzenten ein lange nachwirkendes Werk geschaffen, in dem wir uns selbst begegnen.
|