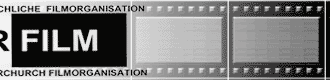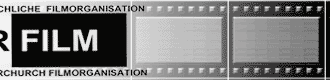31. März 2004
Visionärer Kult des Blutes – Mel Gibsons »Die Passion Christi«
Von Karsten Visarius
(Dieser Text erschien zuerst in der epd Dokumentation 13/2004, die weitere Artikel zum Thema enthält und online bezogen werden kann.)
»Es ist genug«, befiehlt der römische Offizier, der die Geißelung beaufsichtigt. Für eine erlösende Atempause wird die Folge der Stockhiebe unterbrochen, die sadistische Soldaten mit aller Kraft gegen den Leib des längst zusammengesunkenen Mannes führen, blutig der Rücken, blutbespritzt das Pflaster, in dessen Ritzen sich Blutbäche sammeln. Wir haben das Krachen der Schläge gehört. Wir haben die Fausthiebe gesehen, die das Antlitz des Mannes verunstalten, wir haben ihn in Ketten davongeschleift, in Ketten geschnürt eine Mauer herabstürzen sehen, keuchend, um Luft ringend, zum Vergnügen seiner Peiniger. Die Atempause verstreicht. Mit breitem Grinsen greifen die Soldaten nach den nächsten Folterwerkzeugen, Peitschen mit scharfen Metallplättchen, dazu bestimmt, die Haut vom Fleisch zu reißen. Es ist noch lange nicht genug. Es ist nur der Anfang - der Anfang von Mel Gibsons Film »Die Passion Christi«.
Gibson erzählt die letzten zwölf Stunden im Leben Jesu, von der Gebetsnacht im Garten Gethsemane bis zum Tod am Kreuz. Eine derart von Blut, Gewalt und Leid besessene Passion hat das Kino noch nicht gesehen. In einer den Rekord feiernden, auf den Fetisch des Maximums fixierten Zeit mag  eine solche Überbietung allein genügen, das Interesse des Publikums zu erregen. Und die Erinnerung an ein aus dem Geist eines armen, asketischen Kinos stammendes, Maßstäbe setzendes Film-Evangelium wie das von Pier Paolo Pasolini zu verdrängen oder gar auszulöschen. Pasolinis »Das 1. Evangelium - Matthäus« war realistisch in seiner Begrenzung, zeichenhaft in seinen Aussparungen, wortbezogen in seiner Szenenfolge und ergreifend in seiner Einbeziehung der Musik Johann Sebastian Bachs. Es war das Werk eines marxistischen Häretikers, der in der biblischen Erzählung vom Leben und Sterben Jesu ein Gegenbild für seine Verzweiflung an der Gegenwart fand. Kurz, es war franziskanisches Anti-Kino, gerichtet unter anderem gegen den erbaulichen biblischen Monumentalfilm der Tradition, ob aus Hollywood oder Cinecittà. Gibson hat im Matera der süditalienischen Basilacata gedreht wie Pasolini und ebenso in Cinecittà, in der die Kulissen seines Jerusalems gebaut wurden. Er will beide beerben, den künstlerischen Einzelgänger wie die demokratische Massenunterhaltung. Die Mischung von Ambition und Kalkül, von Ehrgeiz und Berechnung hat einen erschreckenden, manchmal kaum erträglichen Film erzeugt. eine solche Überbietung allein genügen, das Interesse des Publikums zu erregen. Und die Erinnerung an ein aus dem Geist eines armen, asketischen Kinos stammendes, Maßstäbe setzendes Film-Evangelium wie das von Pier Paolo Pasolini zu verdrängen oder gar auszulöschen. Pasolinis »Das 1. Evangelium - Matthäus« war realistisch in seiner Begrenzung, zeichenhaft in seinen Aussparungen, wortbezogen in seiner Szenenfolge und ergreifend in seiner Einbeziehung der Musik Johann Sebastian Bachs. Es war das Werk eines marxistischen Häretikers, der in der biblischen Erzählung vom Leben und Sterben Jesu ein Gegenbild für seine Verzweiflung an der Gegenwart fand. Kurz, es war franziskanisches Anti-Kino, gerichtet unter anderem gegen den erbaulichen biblischen Monumentalfilm der Tradition, ob aus Hollywood oder Cinecittà. Gibson hat im Matera der süditalienischen Basilacata gedreht wie Pasolini und ebenso in Cinecittà, in der die Kulissen seines Jerusalems gebaut wurden. Er will beide beerben, den künstlerischen Einzelgänger wie die demokratische Massenunterhaltung. Die Mischung von Ambition und Kalkül, von Ehrgeiz und Berechnung hat einen erschreckenden, manchmal kaum erträglichen Film erzeugt.
»Die Passion Christi« von Gibson ist in erster Linie und fast ausschließlich die möglichst realistische Darstellung einer endlos gedehnten, blutigen Folter. Wer in der Lage wäre, allein den Bildern und Tönen zu folgen, wer nur sieht und hört, als wäre er unbeschrieben von der ganzen kulturellen Bedeutung, der historischen Wirk- samkeit und religiösen Dimension des Erzählten, der nähme vor allem eine bis an die Grenzen des Erträglichen getriebene Tortur wahr. Ein Schlag treibt einen eisernen Dorn in Jesu Schläfe. Unablässige Hiebe setzen dem unter dem Kreuz Zusammenbrechenden zu. Das Schultergelenk reißt bei der Nagelung an den Kreuzesbalken. Manches erinnert an die Mutproben, die subkulturelle Genres wie Horror- und Splatterfilme bei ihrem jugendlichen Publikum herausfordern. Wer wagt es noch hinzuschauen?
Das Kino kennt seit seinen Anfängen den verstörenden Reiz der Gewalt. Es ist als ein Produkt der Moderne schon immer im Bunde mit archaischen Affekten. Es erinnert uns an die Sensibilität und Aggressivität unseres Leibes, die wir im bürgerlichen Alltag zu ignorieren, zu verdrängen und zu vergessen gelernt haben, normalerweise. Leiden und Töten, Fliehen und Überwältigen sind die Pole dieser leibgebundenen Affektausstattung. Das Kino ist manchmal ihr Ventil, manchmal ihr Verstärker. Und manchmal auch ihr Spiegel, in dem wir mehr von uns erkennen, als uns lieb ist.
Gibsons Film benutzt diese Kinowirkungen, aber er zielt darüber hinaus. »Mad Max«, oder der größte Verrückte, hieß der Film, mit dem Gibson als Schauspieler berühmt wurde, ein apokalyptisches Spektakel in drei Sequels, in dem er den Retter für die Restbestände einer durch eine selbst verschuldete Katastrophe dezimierten und auf das Überlebensnotwendige zurückgeworfenen Menschheit spielte. Schon in dieser Rolle verkörperte er eine Erlöserfigur, die, blickt man auf seine Kinokarriere zurück, seine Bestimmung werden sollte. Gewalt und Leid, ein sadomasochistisches Grundmuster, zieht sich als Konstante durch sein filmisches Werk, ob er sich als schottischen  Freiheitskämpfer in dem oscarprämierten »Braveheart« oder als antikolonialen amerikanischen Rebell in »Der Patriot« inszenierte. In »Die Passion Christi« erfährt dieses Muster seine sakrale, gesteigerte Überhöhung. Freiheitskämpfer in dem oscarprämierten »Braveheart« oder als antikolonialen amerikanischen Rebell in »Der Patriot« inszenierte. In »Die Passion Christi« erfährt dieses Muster seine sakrale, gesteigerte Überhöhung.
Es ist leicht zu verstehen, dass Zuschauer von Voraufführungen des Films erschüttert waren. Filmische Gewalt verfehlt selten ihren Effekt, jenseits aller ästhetischen Qualität. Zumal ein naives Publikum erliegt der Realitätsillusion, die das Kino erzeugt. Es vergisst, dass im Kino noch der heftigste Eindruck künstlich gemacht worden ist, entstanden aus Kamera, Licht, Special Effects, Farbe, Kulissen, Modellen, Masken, Mischung, Nachbearbeitung, lauter technischen Sachen, die, wie Hitchcock einmal sagte, das Publikum zum Schreien zu bringen vermögen. Es vergisst, dass das Blut auf der Leinwand kein Blut ist.
Im vergossenen, aus dem verwundeten Leib rinnenden Blut fließen Leid und Gewalt zusammen. Gibson hat es zum zentralen Symbol seines Filmes gemacht, und in einer der wenigen und kurzen Rückblenden, die er dem Leben Jesu und seiner Lehre einräumt, verknüpft er es mit der Einsetzung des Abendmahls. Die Frauen, Maria und Maria Magdalena, entsetzte Zuschauer des Martyriums wie wir, tupfen mit weißen Tüchern das Blut auf wie eine Reliquie. Es zeichnet ihre Gesichter wie vorchristliche Priesterinnen. Mehrfach zeigt uns der Film das blutgetränkte Schweißtuch der Veronika, eine legendäre Zutat der Passionsgeschichte. Der Legionär, der Jesus die Lanze in die Seite sticht, wird von einer Blutdusche überrieselt, vom Blut gereinigt und geläutert. Und immer wieder rückt uns die Kamera den blutüberströmten, blutverkrusteten Leib Christi vor Augen, bis dahin, dass wir nichts mehr sehen wollen. Im Anblick des Blutes soll das Erschrecken in religiöses Erschauern übergehen. Gibson treibt einen filmischen Kult des Blutopfers, der die Passion remythisiert. Eine kurze, die Auferstehung andeutende Sequenz zum Schluss erlöst den Zuschauer nicht mehr. Der Sinn einer Erzählung hängt auch vom Sinn für das Maß ab. Gibsons religiös inspirierte Maßlosigkeit verletzt die Proportion der Geschichte, die die Evangelien erzählen. Gerade sie überliefern uns ja eine Botschaft, die die Sakralität des Opfers überwindet.
In diesem Zusammenhang erhält auch der Vorwurf des Antisemitismus sein Gewicht, den besorgte Vertreter jüdischer Organisationen gegen den Film erhoben haben. Dafür ist nicht entscheidend, ob Gibson eher den Juden oder den Römern die Schuld am Tod Jesu zuweist. Für ihn, so hat der Regisseur den Vorwurf zu entkräften versucht, seien wir alle an diesem Tod schuldig. Der Film selbst macht die jüdischen Hohenpriester, die unerbittlich die Kreuzigung Christi fordern, moralisch für sie verantwortlich, die Römer für ihre Ausführung. Schwerer wiegt die Ignoranz Gibsons gegenüber der Wirkungsgeschichte, die die Passion in der christlichen Welt entfaltet hat. Sie hat den Juden eine fort- währende Blutschuld zugeschrieben, die ein Pogrom nach dem anderen rechtfertigen musste. Heinrich Heines »Rabbi von Bacharach« ist ein literarisches Zeugnis, das diese aus Blutfantasien geborene Mordlust anprangert. Nach dem Holocaust der Nazis, der auch auf dem christlichen Antijudaismus aufbauen konnte, haben die christlichen Kirchen ihre Verantwortung für die Verbrechen an den Juden angenommen. Die Theologie reflektiert seitdem die Verwurzelung Jesu im Judentum. Mel Gibson und seine »Passion Christi« wissen nichts von dieser Verantwortung. Sie liegt für seine Naivität wie für seinen Glaubenseifer jenseits des Horizonts.
Aus dem Umkreis der deutschen Romantik, der Heine noch im Widerspruch und im Exil verbunden blieb, stammt eine Inspirationsquelle von Gibsons Film, die in den meisten Reaktionen bisher keine Berücksichtigung findet. Der Regisseur selbst hat sie keineswegs verschwiegen. Auf der Fan-Website des Films wird für ihre englische Übertragung ausdrücklich geworben. Es handelt sich um ein im 19. Jahrhundert durchaus populäres, in zahlreichen Sprachen verbreitetes und später vergessenes Buch - die Kreuzigungsvisionen der stigmatisierten Augustinernonne Anna Katharina Emmerich (oder Emmerick), die der katholisch und fromm gewordene Dichter Clemens Brentano aufzeichnete und unter dem Titel »Das bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi« veröffentlichte. Mehrere Jahre widmete Brentano, einer der musikalischsten Lyriker der romantischen Dichtung, der Niederschrift der Visionen, die der bettlägerigen Nonne widerfuhren. Es war eine religiös inspirierte »folie à deux«, ein sich gegenseitig verstärkender psychischer Erregungs- und Trancezustand, der die beiden verband, eine bei Brentano aus Reue über fehlgeschlagene erotische Passionen genährte, bei der Nonne in ihrem Siechtum manifestierte Leibfeindschaft, die ihre Inspiration entfachte.
Diese Quellen sind keineswegs versiegt. Unsere aufgeklärte, saturierte Zeit schüttelt den Kopf über eine grassierende Bulimie, über ein asketisches Fitnesstraining, über junge Mädchen, die von Selbstverletzungen nicht lassen können. Sie wendet sich ab von Fernsehbildern sich geißelnder, im Schmerz entrückter Schiiten, die zum heiligen Schrein in Nadschaf wallfahrten. Sie nimmt therapeutische Reklameversprechen auf »out of body experiences« als Randphänomene wahr. Mit Gibsons »Die Passion Christi« taucht eine verwandte Disposition mitten in unserer Öffentlichkeit und mit der ganzen Wirkungsmacht des Kinos auf. »Die breite Schilderung der Leiden Jesu, des ‚liebsten Bräutigam‘, wie der traditionelle mystische Topos lautet, ist von einer kaum überbietbaren Grausamkeit in der Darstellung der erlittenen Martern«, heißt es in einem Literaturlexikon zu den Kreuzigungsvisionen der Emmerich. Man glaubt, eine aktuelle Rezension von Gibsons Film zu lesen.
Im westfälischen Dülmen und nicht in Hollywood wurden diese Bilder geboren. Anders gesagt: sie lagen bereit. Und sie werden plötzlich emporgeschleudert von dem künstlerischen Medium, das wie kein anderes zu einer visionären Wahrnehmung bestimmt zu sein scheint, in der Realität und Reflexion versinken. Die autosuggestiv erregte, von der imitatio der Leiden Christi inspirierte Visionärin Anna Katharina Emmerich glaubte, eine Zeugin des überzeitlichen Geschehens der Passion zu sein, einer Wahrheit, die die Vernunft übersteigt. Brentano glaubte, in ihrer literarischen Gestaltung seine Sendung gefunden zu haben. Mel Gibson glaubt, in der Filmkamera das Instrument zu besitzen, um visionäre Zustände unmittelbar und mit suggestiver Wirkung für ein Massenpublikum sichtbar zu machen. Die Kinoerfahrung soll zur mystischen Schau werden. Als die Kirche das Kino entdeckte, hoffte sie, es für missionarische Zwecke nutzen zu können. Jetzt stößt sie auf das Phänomen, dass Menschen ihre Glaubenserfahrungen nicht mehr aus Gottesdienst und Bibellektüre, sondern aus dem Kino beziehen, das seiner eigenen Mission folgt.
|