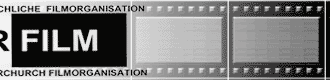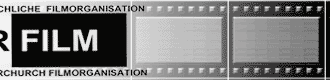1. November 2006
Warum brauchen wir Dokumentarfilme?
Einleitung zum DOK-Summit beim Internationalen Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Leipzig 2006: Zu gut für das Fernsehen? Erfolgskriterien für den Dokumentarfilm abseits der Quote
Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm veranstaltet unter dem Titel DOK Summit traditionell eine Reihe von Podiumsdiskussionen. Am 1. November 2006 fand in der Alten Handelsbörse Leipzig unter der Moderation des Festivaldirektors Claas Danielsen das erste dieser Podien zu Fragen der Qualität des Dokumentarfilms statt. Teilnehmer waren die Dokumentarfilmer Thomas Frickel (zugleich geschäftsführender Vorsitzender der AG Dokumentarfilm) und Dieter Grabe, lange Zeit Redakteur des ZDF, die Journalistin Dr. Grit Lemke, die Produzentin Katrin Schlösser und Andres Veiel, Dokumentarfilmer aus Berlin. Die im folgenden dokumentierte Einleitung hielt Karsten Visarius, Executive Director von INTERFILM.
Das Festival hat mir freundlicherweise einen großen Spielraum für Thema und Richtung meiner Einleitung gelassen. Es hat mich damit aber auch in eine gewisse Ratlosigkeit gestürzt. Über Fragen der Qualität von Dokumentarfilmen solle ich sprechen, lautete die Bitte, und irgendwann schien mir, dass ich damit die Frage nach dem Dokumentarfilm überhaupt, seinem Sinn, seinem Zweck und seinem Wesen beantworten müsste – eine Vorstellung, die einen leichten Anfall von Schwindel auslöst, ein Gefühl, sich im Bodenlosen zu verlieren. Ein Blick auf das Thema unserer Podiumsdiskussion macht die Sache nicht viel einfacher. Es enthält, indirekt und versteckt, aber unüberhörbar, einen Appell und eine Überzeugung, nämlich: Der Dokumentarfilm ist so gut, so wichtig, bedeutsam oder sogar unentbehrlich, dass er auf jeden Fall ins Fernsehen gehört, unabhängig von den Einschaltquoten, die er erreicht oder die man mit ihm erreichen möchte. Jedenfalls lässt sich das, was den Dokumentarfilm wichtig und bedeutsam macht, nicht in Einschaltquoten messen. Ich teile diese Überzeugung und unterstütze diesen Appell, wenn er denn so gedacht war. Sie beziehen sich darauf, dass das Fernsehen, insofern es öffentlich-rechtlich organisiert ist, den Zuschauer grundsätzlich nicht als Konsumenten, sondern als Staatsbürger anspricht. Das gilt auch dann, wenn der Zuschauer ein ums andere Mal nicht gewillt oder fähig ist, diese Rolle anzunehmen, gewissermaßen, um mit Jürgen Habermas zu sprechen, kontrafaktisch. Nur dann behält der (ungeschriebene) Vertrag zwischen dem Gebührenzahler und dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen seine Gültigkeit. Genau in diesem Rahmen müssen wir jedoch die Frage beantworten: Warum brauchen wir Dokumentarfilme? Ich werde im folgenden versuchen, nicht die Antwort, aber doch Elemente und Stichworte für Antworten auf diese Frage zu finden.
Vor diesem Versuch will ich jedoch etwas zurücktreten und das Panorama der gegenwärtigen Situation skizzieren. Dazu gehört erstens die überraschende Entwicklung, dass der Dokumentarfilm das Kino zurückerobert. Über die kulturellen Schutzzonen der Dokumentarfilmfestivals und der kommunalen Kinos hinaus ziehen Dokumentarfilme wieder ökonomisch relevante Teile des Kinopublikums an, bis hin zu den spröden Exerzitien von Philipp Grönings Klosterfilm „Die große Stille“ (2005). Für das Image, für den kulturellen Status des Dokumentarfilms lässt sich der wiedergefundene Wirklichkeitshunger des Kinopublikums gar nicht überschätzen – nicht wegen der Stoffe, sondern wegen der Form, für die dieses Publikum sich engagiert. Ich würde, Philipp Gröning eingeschlossen, von einem erotischen Enthusiasmus sprechen, der diese Filme beseelt und dem die Zuschauer offenbar zu folgen bereit sind. Es ist der Funke, der überspringt, der einem Dokumentarfilm nicht fehlen darf. Versteht sich, dass solche Funken jenseits von Quotenkalkül liegen: Sie sind das Unberechenbare per se.
Zweitens will ich, wenigstens en passant und bei aller Zweischneidigkeit, die Vergrößerung der Abspielflächen für Dokumentarfilme durch die digitalen Fernsehkanäle erwähnen. Dadurch werden zumindest die Arbeitsmöglichkeiten, nicht unbedingt auch die Ausdrucksmöglichkeiten für Dokumentarfilmer erweitert. In entgegengesetzter Richtung wirken, jedenfalls nach meinem Eindruck, drittens die neuen Plattformen für das Abspiel von Filmen im Internet, die erstmals Professionelle und Amateure prinzipiell gleichstellen. Ich vermute, dass dieses immer noch in den Kinderschuhen steckende Riesenbaby künftig alle im wesentlichen von persönlicher Betroffenheit zehrende dokumentarische Ausdrucksformen aufsaugen wird. Das ist nicht wenig. Dokumentarfilmer werden mehr bieten müssen.
Zuletzt und viertens will ich die Verbilligung von technischer Ausstattung und Material durch die digitalen Techniken nennen. Sie verschiebt das Verhältnis von Aufwand und Resultat zugunsten der Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten des Filmemachers. Teuer in jeder Hinsicht wird immer mehr, was sie oder er an Aufmerksamkeit, Findigkeit, Lebenszeit, Kreativität und Engagement inklusive Entbehrungen aufzubringen bereit und in der Lage sind. Insgesamt ergibt sich für den Dokumentarfilm ein nicht ungetrübtes, aber dennoch ermutigendes Bild. Die Sicherheiten durch zuverlässige Auftraggeber werden kleiner, aber der Bedarf wächst – auch für Dokumentarfilme, die auffallen, weil sie anders sind. Das sind die Filme, die wir brauchen.
Damit bin ich bei der Frage, was Dokumentarfilme wichtig macht. Die Beispiele, die ich dazu gewählt habe, stammen alle aus dem Kino, auch wenn sie, ebenso unvermeidlich wie zum Glück, von Fernsehsendern mitproduziert worden sind. Dort, im Kino, entstehen immer noch die Maßstäbe für das, was Film ist und sein kann. Mein erstes Beispiel ist „Rhythm is it“, ein für alle überraschender Hit in den Kinocharts, ein Film mit konventionellen Mitteln, die ganz hinter seinem Stoff zurücktreten. Und doch, dieser Film hat es in sich. Er ist, zuerst und zuletzt, eine hinreißende Demonstration dafür, dass soziale und kulturelle Fragen, die Berliner Philharmonie und die Perspektiven von Jugendlichen in Berlin-Neukölln oder anderswo, untrennbar zusammengehören. Ich finde, kein Dokumentarfilmer, kein Politiker und kein Fernsehredakteur darf diese Erkenntnis ignorieren. Solche nicht abstrakt, sondern durch Anschauung gewonnene Lehren, die uns das Gefühl geben, ein bißchen weiser geworden zu sein, gehören für mich zum wichtigsten Kapital des Dokumentarfilms. Es kommt ein versteckteres, obwohl im Filmtitel plakatiertes Thema hinzu: der Rhythmus, die Verbindung von Musik, Körper, Arbeit und Gesellschaft. Es mag befremdlich klingen, aber der Film legt den Gedanken nahe, dass wir an Arhythmien leiden, an Rhythmus-Pathologien. Was mich zu dem Schluss bringt, dass „gute“ Dokumentarfilme unter anderem auch therapeutische Funktionen haben.
Mein zweites Beispiel ist der Film „Unser täglich Brot“ von Niklaus Geyrhalter, der im Januar 2007 in die deutschen Kinos kommen wird und sich mit dem Stand der Industrialisierung bzw. Automatisierung in der Nahrungsmittelproduktion beschäftigt. Der Film, eine Montage ebenso schauriger wie höchst kunstvoll komponierter Einstellungen, verzichtet nicht nur auf jeglichen Kommentar, sondern auf Sprache, auf Dialog oder Text überhaupt. Er macht damit die Denaturierung unserer Lebensgrundlagen noch krasser spürbar, so dass es auch uns die Sprache verschlägt. Ich will jedoch nicht vom Thema des Films sprechen, bei all seiner Bedeutsamkeit. Er steht für mich vielmehr für den Mut zur riskanten Kommunikation, der den wichtigen, wirklich relevanten Dokumentarfilm auszeichnet. Riskante Kommunikation bedeutet Verzicht auf das Bekannte, auf das schon oft Gesagte und Gezeigte ebenso wie auf eine paternalistische Pädagogik, auf die autoritäre Attitude des Besserwissens. Auf dieser Qualität des Dokumentarfilms zu beharren heißt unvermeidlich, die Grenzen des Fernsehkompatiblen zu testen. Denn das Fernsehen ist auf Wiedererkennbarkeit, auf Standardisierung ausgerichtet – mit dem umgekehrten Risiko, Kommunikation von Bedeutung, von Sinn komplett zu entleeren. Vielleicht sollten Fernsehverantwortliche mehr Angst vor Langeweile als vor einzelnen Quotenfehlschlägen haben. Dennoch, ich fürchte, an dieser Front zwischen Fernsehen und Dokumentarfilm wird es nur Waffenstillstände, aber keine Versöhnung geben.
Ich habe lange gezögert, ob ich in unserem Kontext auch Sönke Wortmanns „Deutschland - Ein Sommermärchen“ erwähnen sollte. Denn er ist ja ein unwiederholbarer Glücks- und Sonderfall. Beim Thema Erfolgskriterien jenseits der Quote kommt man jedoch an einem Dokumentarfilm, der im Kino bereits drei Millionen Zuschauer angezogen hat, nicht ohne weiteres vorbei. Ich finde jenseits von Fußball und nationalem Enthusiasmus dreierlei an diesem Film bemerkenswert. Er bezeugt erstens das unstillbare Interesse, ein Ereignis, an dem man irgendwie beteiligt war, als Bild zu sehen, es in Bildern erzählt zu bekommen. Diese elementare, vielleicht magische Verwandlung ist und bleibt eine unerschöpfliche Quelle für Dokumentarfilme. Zweitens lebt der Film von dem Bedürfnis nach Nähe, nach der Aufhebung von Distanz – eine Nähe, die offenbar nicht von den Konventionen und Klischees der gewohnten, im Sommer erlebten Fernsehberichterstattung erzielt, sondern eher verhindert wird. Dafür brauchten wir einen Regisseur, Sönke Wortmann. Und drittens ist der Film der Triumph einer, fast möchte ich sagen: partisanenhaften Technik, die ihm eine Unmittelbarkeit und Spontaneität von hohem Reiz verleiht. Wir werden erleben, wie andere Dokumentarfilme mit diesen Freiheiten, übrigens auch gegenüber ihren Auftraggebern, umgehen werden. Was schließlich die glückliche Gelegenheit, die besondere Konstellation von individuellem und kollektiven Interesse betrifft, inklusive dessen, der sie beim Schopf zu packen versteht, so muss prinzipiell jeder Filmemacher sie erahnen, aufspüren oder erkennen – aber auch, da beginnen die Leiden, durchsetzen. Die persönliche Intuition, ohne die kein einziger relevanter Film zustande kommt, lässt sich nur begrenzt in sachliche Argumente umsetzen. Produzenten und Redakteure müssen an diesem Punkt eher Menschenkenner als Quotenverwalter sein.
Meine letzten beiden Beispiele sind älter, es sind Klassiker, und wenn es die Gelegenheit für einen gemeinsamen Workshop für Filmemacher und Fernsehredakteure zur Frage von Qualitätsmaßstäben von Dokumentarfilmen gäbe, würde ich sie ins Zentrum stellen. Ich will, leider nur kurz, von Johann van der Keukens „Die großen Ferien“ sprechen und von Chris Markers „Sans soleil – Ohne Sonne“. Der eine handelt davon, was es heißt, Dokumentarfilmer zu sein, der andere untersucht, was es heißt, die Welt in Filmbildern festzuhalten. Der krebskranke Johann van der Keuken reist mit der Kamera durch die Welt, um ein Mittel gegen den Tod zu finden. Und wir können sehen, dass Filmen heißt, sein Leben einzusetzen. Chris Marker nimmt uns mit auf eine Reise durch Bilder, die immer tiefer in den Innenraum des Gedächtnisses, des Verstehens, des Wissens und Fragens führen, bis wir anfangen zu staunen, dass sich in Bildern die Wirklichkeit zeigt, bis in ihnen der Glanz des Wirklichen erscheint: wieder erscheint. Ist das quotentauglich? Ich fürchte nein. Aber ich wünsche mir, dass nicht nur die Quote, sondern auch die Erinnerung an Johann van der Keuken, an das Drama des Filmemachens, und an Chris Marker, an die Offenbarung des Wirklichen, über zukünftige Dokumentarfilme entscheidet.
Karsten Visarius/31.10.2006
|