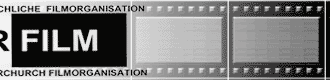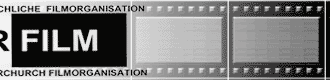Leipzig
44. Internationales Leipziger Festival
16. bis 21. Oktober 2001
Eine gute Woche vor dem Eröffnungsabend des Festivals fielen die ersten amerikanischen Bomben auf Afghanistan – kein Wunder, daß die Schatten des Krieges bis nach Leipzig reichten. Bis zu einem Festival, das sich dezidiert als Forum für den politischen Film versteht, das in hartnäckiger Treue immer noch die Friedenstaube im Schilde führt – und sie auf Plakaten, Spruchbändern und Logos durch das Stadtbild flattern läßt.
Sehen, was wirklich los ist – auch der Slogan des Festivals bekam eine Brisanz ganz eigener Art: angesichts einer von militärischen Interessen dominierten Öffentlichkeitsarbeit, die sorgfältig vorsortiert, was das Publikum zu sehen bekommt als die Bilder dieses Krieges. Grünstichige Explosionen vor nächtlichem Himmel sehen – und dabei blind bleiben für die Hintergründe, die Folgen und die Auswirkungen der Flächenbombardements und Flüchtlingsströme: dieses Ohnmachtsgefühl prägte die Tage von Leipzig. Dankbar und erleichtert nahmen wir die Filme zur Kenntnis, die uns zu zeigen versuchten, was wirklich los ist, die einen Blick erlaubten auf die Welt hinter der nachrichtlichen Oberfläche.
Die kluge Regie der Festivalleitung hatte einen Eröffnungsabend gestaltet, der dieser Stimmungs- und Gefühlslage in Worten und Bildern Ausdruck verleihen konnte: mit einer bewegenden Ansprache von Friedrich Magirius, dem Leipziger Superintendenten zur Wendezeit, die den Freiheitswillen der Montagsdemonstranten noch einmal aufscheinen ließ und die protestantische Bürgerlichkeit als einen Wurzelgrund der gastgebenden Stadt. Und mit einem Filmprogramm, das die Zuschauer mit gut durchdachten Ausflügen in die Filmgeschichte mitten hinein in die aktuellen Fragestellungen lotste: in New York von Albert Benitz (1936) noch einmal die ungebremste Fortschrittseuphorie schmecken, die das Wachsen der Sehnsuchtsmetropole gerade in europäischen Augen ausgelöst hat, mit endlosen Kamerafahrten am Empire State Building entlang, mit den wohlbekannten Wolkenkratzerpanoramen aus der Hudson-Perspektive, die niemand mehr unschuldig betrachten kann. Die Schrecken des Bombenkrieges sehen in den tonlosen Dokumenten des Leipziger Stadtarchivs, die die Folgen der alliierten Angriffe auf Leipzig in den zerstörten Straßenzügen und den zerstörten Gesichtern zeigen – und auf einmal wird Leipzig 1943 auf der Leinwand transparent für Kabul und andere gegenwärtige Stationen der Vorhölle. Oder die Entstehung des Krieges im Spiegel eines Kinderspiels erleben – in Das Spiel von Dusan Vukotic (1962), einem Animationsfilm, der die ganze Skala der Eskalationsstufen nachzeichnet von der harmlosen Neckerei bis zur haßerfüllten Totalvernichtung.
In den fünf folgenden Festivaltagen hat die Ökumenische Jury 19 Wettbewerbsfilme gesehen – und sich eine Auswahl aus dem reichhaltigen Programm des Animationswettbewerbs zeigen lassen. Wir haben mehrfach unsere Eindrücke ausgetauscht und schließlich fünf Filme in die engere Wahl genommen, die alle von den verschiedenen Jurys mit Preisen bedacht wurden.
Unseren Hauptpreis haben wir - nach längerer Diskussion – an den israelischen Beitrag Eingeschlossen/Asurot vergeben. Anat Even und Ada Ushpiz, zwei israelische Filmemacherinnen, haben ein Haus in Hebron gefunden, das in kaum aushaltbarer Verdichtung den mörderischen Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis verkörpert. Najwa, Nawal und Siham, drei palästinensische Witwen mit insgesamt elf Kindern, bewohnen das Haus – der Film beginnt, als eine der Mütter ihren jüngsten Sohn, drei oder vier Jahre alt, zu Bett bringen will. Der gehorcht nicht gleich aufs Wort und wird von seiner Mutter mit heftigen Klapsen und deftigen Flüchen ins Schlafzimmer gejagt. Schon diese Eingangssequenz macht den ungeheuren Druck spürbar, unter dem die Rumpffamilien leben – denn ihr Haus ist besetzt von der israelischen Armee. Die hat auf dem Dach einen Beobachtungsposten eingerichtet. Die Soldaten steigen schwer bewaffnet und stumm durchs Treppenhaus, sie pinkeln neben die Wassertanks der Bewohner und werfen ihre Zigarettenkippen achtlos in der Gegend herum. Sie verbieten es den Frauen, das Haus zu verlassen, sie sind mit Funkgeräten und Kommandorufen ständig präsent – und sie schützen die festlichen Umzüge der orthodoxen Siedler zum Purimfest und zu anderen Anlässen, die sich direkt vor den Haustüren der Palästinenser durch die Straßen schieben. Auf engstem Raum existieren diese Welten nebeneinander, die muslimischen Frauen leben in einem doppelten Gefängnis. Eingeschlossen in den strengen Sittenkodex für Witwen und in den Belagerungszustand durch die israelische Armee. In den Augen ihrer Kinder spiegelt sich schon der Hass der kommenden Generationen – bis auf eine kurze, märchenhaft utopische Szene, als plötzlich Schnee über Hebron gefallen ist und sich Soldaten und Kinder ganz aufgeräumt und sehr lebendig eine Schneeballschlacht liefern. Und am Abend hört man den ältesten Sohn lakonisch und erstaunt zu seiner Mutter sagen: „Auf einmal hatte ich das Gefühl, sie seien meine Nachbarn...“

Der Film erhält sein besonderes Gewicht dadurch, daß sich israelische Filmemacherinnen mit dieser Situation konfrontieren. Über ein Jahr lang, so hat es Anat Even in Leipzig erzählt, haben sie mit den Frauen nur geredet und immer wieder geredet, bevor es möglich war, mit den Dreharbeiten zu beginnen. Nur so konnte es vermutlich gelingen, daß Najwa, Nawal und Siham so offen über ihre Situation, über ihre Ängste und ihre kleinen Fluchten reden. Auch wenn der Film selbst kaum Hoffnung macht auf eine Lösung der festgefahrenen Situation: daß er in dieser Konstellation zu Stande kam, ist schon das eigentliche Ereignis. Eingeschlossen hat in Leipzig auch den Hauptpreis der Internationalen Jury, die Goldene Taube für Dokumentarfilm/Langmetrage erhalten).
Mit sehr viel Sympathie haben wir den Film Casting von Emmanuel Finkiel (Frankreich) gesehen. Für ein Spielfilmprojekt hat der Autor zwischen 1994 und 1998 in der jüdisch-aschkenasischen Gemeinde von Paris nach Laienschauspielern gesucht. Einzige Bedingung: die Darsteller sollten des Jiddischen mächtig und älter als 65 sein. Ganz unangestrengt entfaltet sich im Laufe der ersten Interviews und Sprechproben und beim tastenden Nachspielen kleiner Szenen das Panorama einer Welt, die unaufhaltsam verschwindet – aus den Interviews entwickeln sich mehr oder weniger beiläufig Lebensgeschichten, die alle Schrecken des 20. Jahrhunderts in sich tragen. Die sie gelebt haben, haben sich trotz allem einen lebensklugen Humor bewahrt – und eine beispielhafte Fähigkeit, sich auch in schwierigen Lebenssituationen nicht aufzugeben. Mancher Entertainer erlebt in Casting seine allzu späte Entdeckung für den Film, und mehr als einmal wissen die Zuschauer nicht mehr, ob sie da gerade einem Interview oder einer Probe oder einer ganz persönlichen Reise in die Erinnerung beiwohnen dürfen. Casting hat in Leipzig den Preis der ver.di-Jury erhalten und ist durch die Internationale Jury sowie durch die FIPRESCI-Jury mit einer lobenden Erwähnung ausgezeichnet worden.
Lange hat uns der russische Film Der Ort des jungen Filmemachers Sergej Loznica aus St. Petersburg beschäftigt. In einer für westliche Sehgewohnheiten nahezu unerträglichen Langsamkeit beobachtet er in streng komponierten Schwarz/weiß-Einstellungen die Bewohner eines Dorfes, deren Abweichungen von der Norm des gewohnten Verhaltens erst langsam ins Bewußtsein der Zuschauer dringen. Der Ort – das ist ein Heim für psychisch Kranke, irgendwo in den Tiefen der russischen Provinz, und die Bewohner dieses Ortes leben nach ihrem eigenen Tempo. Ernte, Mittagessen, Feldarbeit - jede Einstellung steht so lange, bis sie uns ihr spezifisches Geheimnis offenbart hat, bis die Leinwand transparent wird für die Wirklichkeit, den Duft der Strohballen, den Rhythmus einer Heugabel. Bewegte Bilder aus dem Geist der Ikonenmalerei: eine wohltuende Zumutung für unsere Augen – wenn sie es denn aushalten. Für Der Ort erhielt Sergej Loznica (schon zum zweiten Mal nach 2000) die Silberne Taube der Internationalen Jury zugesprochen.
In weniger kriegerischen Zeiten wäre wahrscheinlich Absolut Warhola von Stanislaw Mucha für unsere Jury wie auch für andere absolut ein Favorit gewesen. Der polnische Regisseur nimmt uns mit auf eine Reise ans Ende der europäischen Welt – die gleichzeitig ins Herz der künstlerischen Avantgarde führt: nach Ruthenien, genauer gesagt nach Medzilaborce und Miková. Aus dieser Gegend im Dreiländereck von Polen, Tschechien und der Slowakei stammt Andy Warhol, hier leben seine Verwandten bis heute – und sie haben sich ihre ganz eigenen, oft recht avantgardistischen Meinungen über den weltberühmten Neffen, Großneffen und Cousin gebildet. Außerdem steht in Medzilaborce das einzige Pop-Art-Museum Europas: hier regnet es zwar ständig durchs Dach, aber der Direktor verfügt trotzdem über einen unglaublichen und einzigartigen Fundus an Werken Warhols. Mit denen war der Meister der Pop-Art wohl sowieso ziemlich freigiebig, denn in den Paketen an die ruthenische Verwandtschaft war neben den bekannten Campbell’s-Suppendosen öfter auch eine Graphik verstaut. Eigentlich bedauert die Verwandtschaft nur eins: daß Andy Warhol nicht in Medzilaborce geblieben ist - sie hätten ihn nämlich auf jeden Fall unter die Haube gekriegt. Absolut Warhola bekam in Leipzig den Planet-Zuschauerpreis; außerdem zeichnete die Internationale Jury Susanne Schüle für die beste Kameraarbeit aus).
Beeindruckt hat die Oekumenische Jury auch der Film Bidul von Jacek Filipiak. In leisen, eindringlichen schwarz/weiß-Bildern verfolgt er die Versuche von drei jungen Frauen, ihr liebloses Aufwachsen in einem polnischen Kinderheim zu verarbeiten. Bidul erhielt in Leipzig Lobende Erwähnungen der Internationalen Jury, der FICC-Jury und der Planet-Zuschauerjury.
Aus der großen Bandbreite der Animationsfilme konnten wir nur eine kleine Auswahl sichten, die uns das Festival freundlicherweise zusammengestellt hat. Wir haben dem kanadischen Film Schwarze Seele/Ame Noire von Martine Chartrand eine Lobende Erwähnung ausgesprochen: sie schafft es, in nur zehn Minuten das ganze Panorama der afroamerikanischen Kultur in einem nie abreißenden Bilderstrom vor unseren Augen zu entfalten.
Wenigstens hinweisen wollen wir aber auch auf Vater und Tochter von Michael Dudok de Witt (Niederlande/Großbritannien). Mit sparsamen, fast herben Strichen in fließenden Brauntönen erzählt er eine sehr einfache und sehr zu Herzen gehende Geschichte und zeigt, warum Töchter Väter brauchen – auch wenn sie selbst schon alte Frauen geworden sind.
Und sonst? Einiges gäbe es noch zu erzählen von anderen Filmen, denen wir auch ein großes Publikum wünschen: Starbuck – Holger Meins von Gerd Conradt rollt noch einmal die Vorgeschichte des Deutschen Herbstes auf – und macht bewußt, wie tief manche Vorgänge schon in Vergessenheit geraten sind. Rudi Dutschke und Otto Schily am Grab von Holger Meins – der derzeitige Innenminister, wen wundert es, wollte sich nicht zu einem Gespräch über Holger Meins und seine eigene Rolle in diesem bundesrepublikanischen Trauerspiel bereit finden. Oder Sacrificio von Erik Gandini und Tarik Saleh, ein Musterbeispiel für eine journalistische Recherche, wie sie Journalisten nur noch selten zu Stande bringen. Hartnäckig versuchen die beiden Schweden, die Umstände des Todes von Che Guevara zu entschleiern – dabei wird die lateinamerikanische Guerilla nach allen Regeln der Kunst entmythologisiert und die Lebenslüge von Régis Debray, dem Mitkämpfer Che Guevaras und späteren Berater von Francois Mitterand, gerät gefährlich ins Wanken. Auch dies ein Beitrag zum Thema Sehen, was wirklich los war – das kann ja auch nach dreißig Jahren noch erhellend wirken.
Wir haben uns in Leipzig insgesamt sehr wohl gefühlt. Die Festivalleitung hat die Arbeit der Oekumenischen Jury aufmerksam und freundlich begleitet – auch wenn wir der Bitte von Festivaldirektor Fred Gehler nicht entsprechen konnten, auf Lobende Erwähnungen zu verzichten. Da ging es uns wie unseren Vorgängern unter den Ökumenischen Jurys – ebenso wie mit der Klage, in der Fülle des Programms nur noch die Wettbewerbsfilme und nicht mehr die Nebenreihen und Retrospektiven und Werkschauen und Sondervorführungen undundund wahrnehmen zu können. Das kennt man ja.
Aber einmal, für eine kurze Stunde, haben wir uns Zeit gestohlen und das Gedächtnis in Bildern besucht – die Retrospektive des Bundesarchiv-Filmarchivs. Und sind natürlich auch gleich belohnt worden: mit der (standesgemäß im 35mm-Format abgegebenen) Liebeserklärung an das Kino des tadschikischen Regisseurs W. Erwais, die den sinnigen Titel Kino trägt: ein klappriger Lastwagen fährt 1970 durchs Pamirgebirge, der Filmvorführer Boinasar Tirandosow auf dem Dach der Welt, ein echter Enthusiast des Kinos: der den Projektor schultert, als die Piste zu Ende ist – und Filmdosen und Apparat über eine atemberaubend klapprige Hängebrücke schleppt. Ein Sprachgenie, der Hamlet in die Hochgebirgsjurten der Hirten bringt, der so lange übersetzt und interpretiert, bis sich in den Gesichtern der Nomaden die Dramen und die grotesken Szenen der Leinwand zu spiegeln beginnen. Das Kino – es kennt wirklich keine Grenzen ...
Kai Voigtländer |