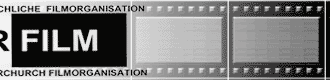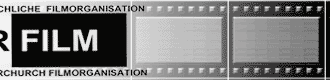Berlin
63. Internationale Filmfestspiele Berlin
7.-17. Februar 2013
www.berlinale.de | Festivalbericht I | Festivalbericht II
PREISE DER ÖKUMENISCHEN JURY
Die Ökumenische Jury, berufen von SIGNIS und INTERFILM, vergibt Preise in den Sektionen Wettbewerb, Panorama und Forum. Die Preise im Panorama und im Forum sind jeweils mit 2.500.- € dotiert, gestiftet von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Katholischen Filmarbeit in Deutschland.
Der Preis im Wettbewerb geht an
Gloria
von Sebastián Lelio, Chile/Spanien 2012

in Würdigung dieses erfrischenden und ansteckenden Plädoyers für die Feier des Lebens, zu der wir alle eingeladen sind, unabhängig von Alter oder Verfassung. Der Film zeigt, dass auch die Schwierigkeiten zu einem Leben in Fülle gehören.
Die Jury vergibt außerdem eine Lobende Erwähnung an den Wettbewerbsfilm
An Episode in the Life of an Iron Picker
von Danis Tanovic, Bosnien-Herzegovina/Frankreich/Slowenien 2013

für den mitfühlenden Blick auf Menschen, die häufig unsichtbar bleiben, und die Darstellung ihrer Würde, Widerstandskraft und den damit verbundenen Lebenswillen.
Im Panorama vergibt die Jury ihren Preis an
The Act of Killing
von Joshua Oppenheimer, Dänemark/Norwegen/Großbritannien 2012

Dieser zutiefst verstörende Film deckt die Massenmorde in Indonesien im Jahr 1965 auf und zeigt die Monstrosität dieser Verbrechen. Er öffnet die Wunde, die die Taten hinterlassen haben und setzt auf die entlarvende Wirkung der Freilegung dieses Grauens.
Eine Lobende Erwähnung geht außerdem an
Inch’Allah
directed by Anaïs Barbeau-Lavalette, Kanada/Frankreich 2012

für seine treffenden Metaphern, Bilder und Geschichten, die Mitgefühl wecken: für den Blickwinkel der Frauen im Kontext des israelisch-palästinensischen Konflikts. Bestimmte Lebenssituationen machen es äußerst schwierig, neutral zu bleiben.
Im Forum verleiht die Jury ihren Preis an
Krugovi (Circles)
von Srdan Golubovic, Serbien/Deutschland/Frankreich/Slowenien/Kroatien 2013

für seine überzeugende Darstellung der menschlichen Fähigkeit, scheinbar unüberwindliche Vorurteile aufzubrechen und Heilung durch Versöhnung zu erreichen.
Die Jury vergibt außerdem eine Lobende Erwähnung an
Senzo ni naru (Roots)
von Kaoru Ikeya, Japan 2013

für das beeindruckende Beispiel eines Neubeginns nach der Tsunami Katastrophe im März 2011. Im Zentrum des Films steht ein alter Reisbauer, der die Kraft für den Wiederaufbau seines Hauses aus der reichen spirituellen Tradition seiner Heimat schöpft.

© Ekko von Schwichow
Die Jury (v.l.): Roland Wicher, Deutschland; Jean-Luc Gadreau, Frankreich;
Maggie Morgan, Ägypten; Gustavo Andujar, Kuba (Jurypräsident)
Charles Martig, Schweiz; Markus Leniger, Deutschland
Berlinale der Frauen
"Gloria" gewinnt Preis der Ökumenischen Jury in Berlin
Von Charles Martig, Filmbeauftragter Katholischer Mediendienst
Mit einer starken Präsenz von Frauen als Regisseurinnen, Darstellerinnen und Produzentinnen war die 63. Berlinale eine löbliche Ausnahme im internationalen Festivalbetrieb. Die Ökumenische Jury zeichnete mit Gloria nicht nur die Lebensfülle dieses chilenischen Films aus, sondern auch die überragende schauspielerische Leistung von Paulina García. Ein weiterer Trend war die starke Präsenz von osteuropäischen Filmen in allen Sektionen. Im Forum zeichnete die kirchliche Jury den serbischen Film Krugovi (Circles) aus, der ein Ereignis aus dem Balkankrieg zum Ausgangspunkt einer herausragenden Geschichte um Schuld und Versöhnung macht.
Es ist kein Zufall, dass der rumänische Film Child’s Pose den Goldenen Bären gewonnen hat. Der sehr differenzierte und dichte Film erzählt von einer Mutter aus der Oberschicht, die ihren Sohn aus den Fängen der Justiz retten möchte. In einem tragischen Autounfall kam ein Kind ums Leben. Der Sohn war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die ganze Energie des Films liegt jedoch bei der alles unter Kontrolle bringenden Mutter. Sie drangsaliert und kontrolliert derart ausgiebig ihre Umgebung, dass die Familie auseinander zu brechen droht. Luminta Gheorghiu verkörpert diese Rolle der Mutter mit solchen einer Eindringlichkeit und unerträglichen Kontrollsucht, dass eine Identifikation mit ihr beinahe unmöglich ist. Und doch kommt es, unter der klugen Regie von Calin Peter Netzer, zu einer erlösenden Begegnung zwischen Mutter und Sohn, zwischen Täter und Opfer, die allerdings die Tragik der Geschehnisse nicht aufheben kann.
Tragische Geschichten – Sehnsucht nach Erlösung
In der deutsch-serbischen Koproduktion Krugovi wird erzählt, was aus Menschen und Beziehungen entsteht, die auf einer Geschichte der Gewalt beruht. Wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, ziehen sich die Wellen der Schuld, des Hasses und der Bitterkeit bis in die nächste Generation. Ist Versöhnung unter diesen Bedingungen überhaupt noch möglich? Der Regisseur Srdan Golubovic hat mit dem Film entscheidende Fragen aufgeworfen und deutet in seiner Geschichte an, dass selbst bei schwersten Verwundungen eine Perspektive für Mitgefühl und Vergebung aufscheinen kann.
Generell hat das osteuropäische Kino in Berlin einen sehr starken Eindruck hinterlassen. So auch der Film Eine Episode im Leben eines Eisensammlers von Danis Tanovic. Dieses Drama zeigt das Leben von Roma in Bosnien-Herzegovina. Laienschauspieler stellen ihr eigenes Leben dar. Der Film ist eine Option für die Armen in Europa, die im täglichen Kampf um ihr Überleben stehen. Was dies für eine Familie mit Kindern bedeutet, zeigt diese Episode eindringlich: in einem authentischen „cinéma direct“, in dem die Kamera einfach den Ereignissen folgt und diese dokumentiert.
Diesem sozialen Kino der Dringlichkeit standen in Berlin gepflegte, historische Dramen gegenüber. Juliette Binoche verkörperte Camille Claudel im Jahr 1915, ein ruhiges Filmgedicht mit meditativen Elementen, in dem die unerhörten Gebete und die Leidensgeschichte von Paul Claudels Schwester dargestellt werden. Oder in La religieuse, eine Adaptation der antiklerikalen Vorlage von Denis Didérot, die in einem Klosterfilm das Schicksal und das Freiheitsstreben einer jungen Frau im 18. Jahrhundert zeigt. Der Regisseur kann dem Stoff kaum etwas Neues abgewinnen. Auch der polnische Priesterfilm W Imie … (In the Name of …) setzt sich mit dem Zölibat auseinander, wirkt jedoch in der Problemlösung etwas rückwärtsgewandt. Interessant ist hier der Blick der Regisseurin Malgoska Szumowska auf das existentielle und sexuelle Leiden des Priesters. Doch angesichts der Dringlichkeit aktueller gesellschaftlicher Probleme, wirkten alle diese explizit religiösen Filme etwas abgehoben und weltfremd.
Täter und Opfer: gewagte Experimente
Im Panorama präsentierte Joshua Oppenheimer seinen verstörenden Doku-Essay The Act of Killing. Er greift darin den Genozid von 1965 auf, bei dem über eine Million Menschen als „Kommunisten“ abgestempelt und umgebracht wurden. Der Film erzählt aus der Perspektive eines Täters, der sich keines Unrechts bewusst ist. Vielmehr brüsten sich der Killer Anwar und sein Kumpan Herman ihrer Taten und zeigen wie sie Tausende umgebracht haben. Sie inszenieren sich dabei als Gangster und Musical-Helden. Der Film ist ein Täter-Porträt von Menschen, die reich geworden und noch heute in Indonesien an der Macht sind. Er gewährt damit einen tiefen Einblick in die Mechanik einer demokratisch getarnten Diktatur, die auf dem Mythos eines heldenhaften Massenmordes aufbaut.
Im Panorama stach mit Inch’Allah ein Film heraus, der aus der Sicht von Frauen den Konflikt zwischen Israel und Palästina darstellt. Geschickt führt die kanadische Regisseurin Anaïs Barbeau-Lavalette mit der Ärztin Chloë eine Figur ein, die zwischen Jerusalem und den besetzten Gebieten hin- und hergeht. Sie hat einen medizinischen Auftrag und muss daher neutral bleiben. Doch die Ungerechtigkeit und die grausamen Opfer, die den palästinensischen Frauen und Kindern abverlangt werden, führen zu einer zunehmenden Orientierungslosigkeit. Der Krieg trifft die Schwächsten und Chloë kann nicht mehr tatenlos zusehen. Die engagierte Erzählhaltung zeigt auf, dass gängige moralische Standards im Krieg nicht mehr gelten und von allen Beteiligten zwangsläufig durchbrochen werden.
Das Leben feiern
Einen deutlichen Kontrapunkt zu den bedeutungsschweren Filmen bot im Wettbewerb Gloria des Chilenen Sebastián Lelio. Beginnend mit einem typischen Midlife-Crisis-Motiv setzt sich die Hauptfigur Gloria mit ihren Wünschen und Bedürfnissen auseinander. Eine Liebesbeziehung wird zum Fiasko. Und so befreit sie sich aus den Erwartungen und Zwängen ihres Umfelds. Wenn sie sich zuletzt zu den Klängen von Umberto Tozzis gleichnamigem Canzone „Gloria“ auf der Tanzfläche bewegt, ist eine befreiende Sicht auf das dritte Lebensalter erzählt. Eine solche Rolle ist ein Geschenk für eine Schauspielerin, die Paulina García voll und ganz ausfüllt. Sie wurde dafür nicht nur mit dem Ökumenischen Preis, sondern auch mit einem Silbernen Bären ausgezeichnet.
Berlinale 2013 – Jenseits von Glamour und Action
Von Heike Kühn
Was ist ein gelungenes Filmfestival, wenn nicht eine experimentelle Erzählung? Filme aus aller Welt zu versammeln, das ist ehrenhaft. Aber den Mut zu haben, diese Welt in Facetten zu zeigen, die sich von der Allerweltserzählung entfernen, das zeichnet die Internationalen Filmfestspiele Berlin aus, auch in ihrer 63. Ausgabe. Gelegentlich liest man, die Berlinale habe nicht genügend Glamour. Oder zu viel davon. Doch möchte ich nach fünfundzwanzig Jahren als Filmkritikerin unumwunden erklären: Bei einem Festival von dieser Größe und Qualität kann jeder mit seiner Auswahl glücklich werden, so er eine trifft. Es ist wahr, dass es Jahrgänge gibt, in denen die Zusammensetzung des Internationalen Wettbewerbs den einen mehr zusagt als den anderen. Aber solange die Leitung der Berlinale Filme wie Pardé, Child´s Pose (Goldener Bär, Preis der FIPRESCI) , Prince Avalanche (Silberner Bär: Preis für die beste Regie) und La Religieuse im Wettbewerb wagt, können ihr auch Filme wie Steven Soderberhgs Side Effects nicht schaden: das Kino der Effekte und des Unterhaltungszwangs, was ist es schon nach einem Jahr in unserer Erinnerung?
Was wirklich bleibt von dieser Berlinale ist die Bewunderung für den iranischen Regisseur Jafar Panahi und seinen mit ihm für die Regie verantwortlichen Hauptdarsteller Kamboziya Partovi. This is not a film hieß Panahis erster Film nach dem ebenso skrupel- wie rechtlosem zwanzigjährigem Berufsverbot, das das Iranische Regime 2010 über ihn verhängte. Pardé vermittelt mit großer Wahrhaftigkeit, wie sich das Aufbegehren gegen zwanzig gestohlene Jahre in lebensbedrohliche Melancholie verwandelt. Gedreht auf Panahis eigenem Grundstück am Kaspischen Meer, entfaltet der Film, dessen Titel „Vorhang“ bedeutet, die Ausmaße einer allgegenwärtigen, vom Regime gewollten Schizophrenie. Ein namenloser Drehbuchautor, sichtlich Panahis Alter Ego, schmuggelt seinen Hund in eine Villa ein. Sie liegt an einer verlassenen Strandpromenade, der Winter und zahllose Vergnügungsverbote halten die Menschen vom Meer ab. In dieser Abgeschiedenheit will er das Risiko des Schreibens eingehen. Dem Hund Auslauf zu gewähren, ist zu gefährlich: Eine Nachrichtensendung, von der man als Filmbetrachter nicht weiß, ob sie fiktiv oder real ist, „dokumentiert“ die Tötung von Hunden als Triumphzug iranischer Reinheitsfanatiker. Der Hund mit dem programmatischen Namen „Boy“ ist leicht als Symbol eines den eigenen Trieben folgenden Lebens zu erkennen, das bis in die natürlichsten Regungen hinein den Kontrollzwängen der Scheinheiligen unterworfen wird. Will der „unreine“ Hund überleben, muss er lernen, ein Katzenklo zu benutzen.

Der Hund, der keiner sein darf, kommentiert jaulend das kümmerlich gefristete Dasein des Drehbuchautors. Während der Autor die Panoramascheiben der Villa mit schwarzen Tüchern verhängt und frustriert leeres Papier zerknüllt, platzen zwei junge Leute in sein Refugium. Reza und Melika behaupten, Bruder und Schwester und auf der Flucht vor der Sittenpolizei zu sein. Der junge Mann verschwindet und lässt die unstete Melika zurück, auch sie eine des verbotenen Lebens Überdrüssige. Melika entpuppt sich als hemmungslos neugierig und vielschichtig provokant. Sie gibt Details aus dem Leben ihres überraschten Gastgebers zum Besten, reißt die Vorhänge herunter und changiert zwischen Opfer und Polizeispitzel, bis auch sie sich schließlich in Luft auflöst.
An diesem Punkt der Erzählung, die sich jetzt als Seelenleben eines Autors erschließt, der seine Hauptdarsteller halluziniert, tritt Jafar Panahi auf und in seine eigene Villa ein. Nun ist es der Autor (Kamboziya Partovi), der sich in einen Geist verwandelt und gemeinsam mit dem Filmpersonal Reza und Melika den Regisseur heimsucht. Die Villa liegt verwüstet und ausgeraubt. Diebe hätten die Scheiben zerbrochen, sagt der Regisseur, der in einem entfernten Dorf nach einem Glaser schickt. Doch wer glaubt, dass es sich hier nur um eine psychoanalytisch verstandene Zerstörung im Haus der Seele handelt, übersieht Panahis poetischen Widerstand: Wer unter Bann einen Film drehen will, bei dem die Banner der Zensur heruntergerissen werden, muss göttlich lügen können. Durch die eingeworfenen Scheiben weht ein frischer Wind – das muss man den Nachbarn, die Teil des heimlich gedrehten Films wurden, ja irgendwie erklären. So fallen die Metapher vom Künstler mit Hausarrest, der seine eigenen Fenster einschmeißt, um aus der paranoiden Abschottung herauszukommen, mit der Realität des Filmemachers und dem kreativen Surplus seines hochkomplexen Films zusammen. Am Ende geht Melika, die lebensmüde Muse, ins Wasser, und der Regisseur folgt ihr. Doch der Film spult sich zurück und meergeboren steigt Jafar Panahi aus den Wellen. Die Natur, der Mythos und die Kunst sind auf seiner Seite. Weder Panahi noch Partovi durften nach Berlin reisen, um den Silbernen Bären für das Beste Drehbuch entgegenzunehmen. Aber Tausende haben gesehen, dass sie sich nicht beugen. Mit wenig Mitteln haben sie einen Film gemacht, der aus ästhetischer und ethischer Sicht eines Tages für den Iran einstehen wird.

Filme wie Pardé gelten im Westen als experimentell oder avantgardistisch, weil scheinbar nicht viel passiert. Und doch wird in diesem vermeintlichen Ungeschehen ein ganzes Land in seinen Beschränkungen, seinem Nicht-sein-dürfen porträtiert. Möglicherweise ist es Zeit, dies als eine erweiterte Form der Filmsprache zu betrachten und die an den Haaren herbeigezogene Action der rastlosen Plotmaschinen als Betrug am Reichtum der Filmerzählung. Das Fehlen von „action“ ist dann auch das auffälligste Kriterium, das sowohl die positiven wie die eher gelangweilten Kritiken hervorheben, die zu François Delisles Film Le météore erschienen. Selbst in einem überreich und mutig kuratierten Programm wie das des diesjährigen FORUM/FORUM EXPANDED sticht der Film des kanadischen Filmemachers hervor: Ihn nachzuerzählen, heißt bereits, ihm eine Form zu geben, die er so nicht hat. Doch erzählen wollen und müssen wir, um zu verstehen. Und eben davon handelt der Film, der jede logische Handlung ausschlägt: Pierre, ein Mann um die Vierzig, sitzt im Gefängnis und wird jede Woche von seiner achtzigjährigen Mutter besucht. Bevor man die beiden zu Gesicht bekommt, hört man aus dem Off, was sie übereinander oder über sich selbst denken. Wie einsam sie sind, wie sehr sie hoffen. Wie sehr sie sich Illusionen hingeben, so wie Pierre, der daran festhält, seine Ehefrau nach 14 Jahren Haft zurückzubekommen; wie deutlich sie über jede Illusion hinaus sind, so wie Pierres sterbende Mutter, die weiß, dass sie den Sohn nicht mehr als freien Mann sehen wird.

Während die Stimmen, zeitversetzt oder zeitlos über Bildern von Wasserfällen, Tieren oder einer blutroten Rose schwebend die Projektionen, Träume und Schuldbekenntnisse der Betroffenen aussenden, sieht man bisweilen Fragmente der beteiligten Körper. So ist die Mutter am Anfang eine Hand mit einem schmalen Ehering, die sich auf der mühsamen Fahrt ins Gefängnis an die Türfüllung eines Taxis lehnt. Der Mörder Pierre, denn als solcher entpuppt er sich in der kräftezehrenden Rekonstruktion seines lange Zeit alle Schuld abstreitenden Unterbewusstseins und der ihn bewusst machenden Filmdramaturgie, bleibt buchstäblich solange unsichtbar, bis er sich selbst sehen kann: Als Drogensüchtigen, der eine Radfahrerin mit dem Auto überrollt und sie flüchtend zum Tode verurteilt hat.
In diese schmerzhafte Aus-einander-Setzung, die das Dickicht von Vorwürfen, Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen zerlegt wie ein Bindestrich den Zusammenhang der geschriebenen Sprache, fließen zudem die Gefühlswelten der Ex-Ehefrau, eines Gefängniswärters und eines frisch verhafteten jungen Drogendealers ein. Sich selbst aus dem OFF erklärend, ja sich selbst belauschend wie einem Fremden, dem man nicht traut, überprüfen sie ihre Motive, ihre Verstrickung in den Mord, der ihr Leben verändert hat. So gelingt es diesem tief in die kollektive Psyche hineinreichenden Film, einen spezifischen Fall von Fahrerflucht und Totschlag als Parabel auszuloten: jenseits der Konkretion der Sippenhaft, unter der Mutter und Ehefrau leiden, jenseits der Traumatisierung des Gefängniswärters, der sich als Gefangenen seines Jobs und seines mühsam anerzogenen Misstrauens erfährt, beschreibt der Film nichts Geringeres als den allerersten Mord auf Erden. Ob Brudermord oder Schwesternmord, das ist nicht entscheidend: das Kainsmal der unterlassenen Hilfeleistung prägt alle, die mit dem Mörder verbunden sind. Hätten seine Eltern ihn anders erziehen, mehr lieben müssen? Seine Frau ihm früher Grenzen setzen sollen? Hätten seine Dealer die Verantwortung übernehmen müssen?

Der Dialog, der üblicherweise die Verhältnisse zu klären versucht, bleibt aus. Stattdessen schieben sich Wolken ins Bild oder das Meer. Stattdessen kommt der junge, dreist grinsende Drogendealer ins Gefängnis und bekundet, dass der Kreislauf von Schuldverdrängung weitergeht. Es sei denn, jeder einzelne übernimmt Verantwortung. Für sich selbst, für den anderen. Für das unbestimmte Dazwischen, das durch den Film zieht wie ein Meteor über den Himmel. Nicht wenige Katastrophenfilme haben solch einen Titel: Wenn dann die Einschläge des Himmelskörpers drohen und das Chaos der Apokalypse genussvoll ausgeschlachtet wird, muss stets ein Held her. Ein Opfer, das die Erde rettet. François Delisles, Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Darsteller der Hauptfigur Pierre in Personalunion, hat auch hier einen bemerkenswert anderen Schluss gewählt. Am Ende inszeniert Pierre, der in Begleitung „seines“ Wärters zur Beerdigung seiner Mutter fahren darf, einen Fluchtversuch und lässt sich erschießen. „Ich komme“, sagt er sterbend zum Himmel. Seine Freiheit kostet einen Mord, den der Nächste begeht. Wir werden, sagt dieser erstaunliche Film, nicht aus dem Teufelskreis entkommen, wenn wir der Action, dem ständigen Ausagieren nicht entsagen.
|